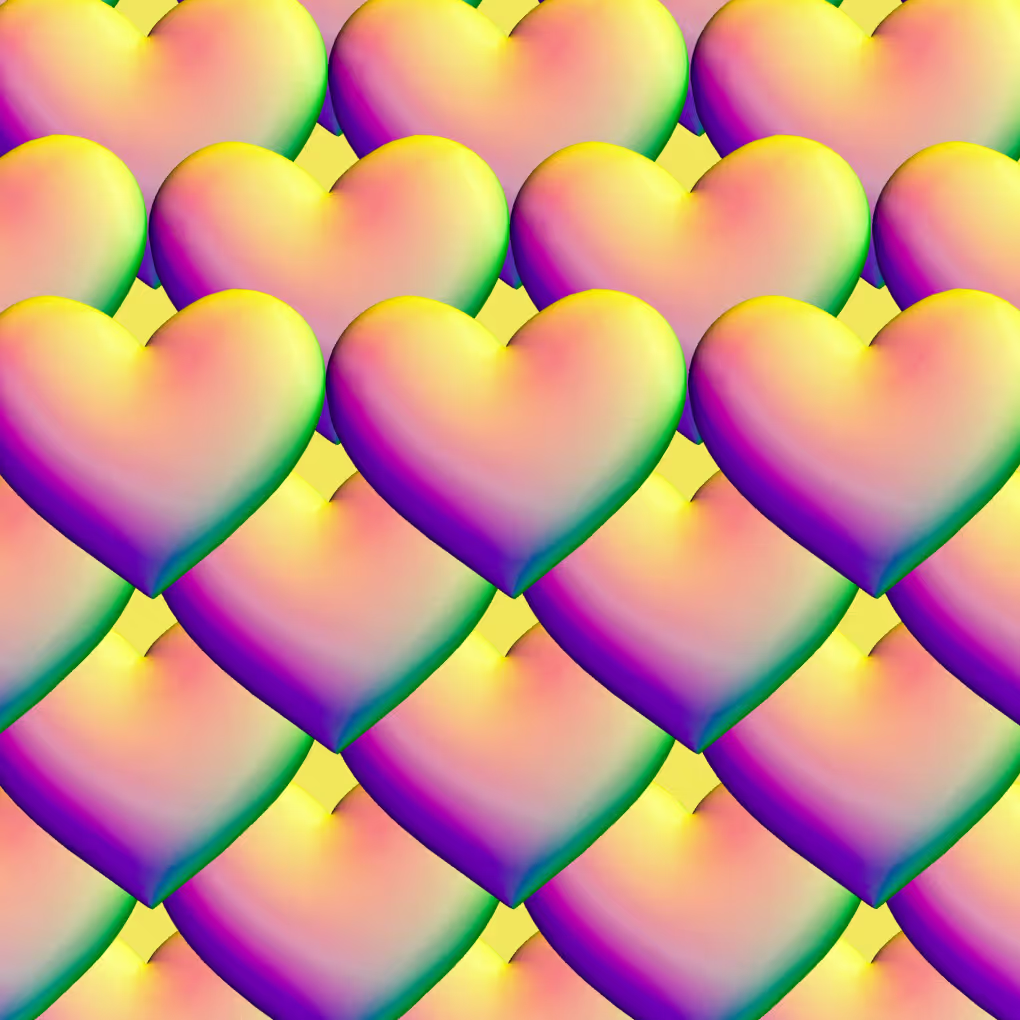Magazin
News und Wissen für dich: Hier erfährst du Neues aus der Welt von Faktor D und bekommst spannende Inputs von Expert*innen aus der Demokratiewelt.
Open Call für unser kommunikatives Toolkit gestartet
In unserem zweiten Skalierungsprozess entwickeln wir gemeinsam ein Toolkit für wirksame demokratische Kommunikation. Sei dabei!
Nur keine Angst vor Fehlern
Um Gefühle wie Angst und Scham zu vermeiden, ist die Unternehmerin, Aktivistin und Autorin Lisa Jaspers lange einer Vermeidungsstrategie gefolgt. Jetzt weiß sie: Kritik ist nicht das Ende, sondern ein Anfang.
Diese sieben Tipps machen (kommunale) Beteiligung besser
Klassische Beteiligungsformate erreichen oft nur die „üblichen Verdächtigen“, sagt Andreas Meinlschmidt. Hier schlägt er vor, wie ein Perspektivwechsel auf bisher wenig erreichte Zielgruppen gelingen kann.
Lasst es raus! Für eine demokratische Emotionskultur
Man sollte den Feinden der Demokratie nicht die Emotionsdominanz überlassen. Der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje plädiert für eine demokratische Integration von Wut und Angst – sowie neue Hoffnung.
News von Faktor D
Das war Mitmacht 2025
Wien wurde zum Treffpunkt demokratischer Zukunft: Beim Mitmacht-Festival vernetzten sich über 200 Teilnehmende in rund 50 Veranstaltungen für eine gemeinsame Agenda.
News vom Mitmacht-Festival
News & Wissen aus Mission #1
News & Wissen aus Mission #2
News & Wissen aus Mission #3
News & Wissen aus Mission #4
Aus unseren Veranstaltungen
Spannende Inputs von Expert*innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz
Diese Expert*innen machen schon mit
Nichts verpassen
Abonniere unseren Newsletter und erfahre stets das Neueste zu unseren Angeboten. Oder werde Abonnent*in unseres neuen Mailmagazins Brief und erhalte regelmäßig Analysen, Strategien und Good Pratices.

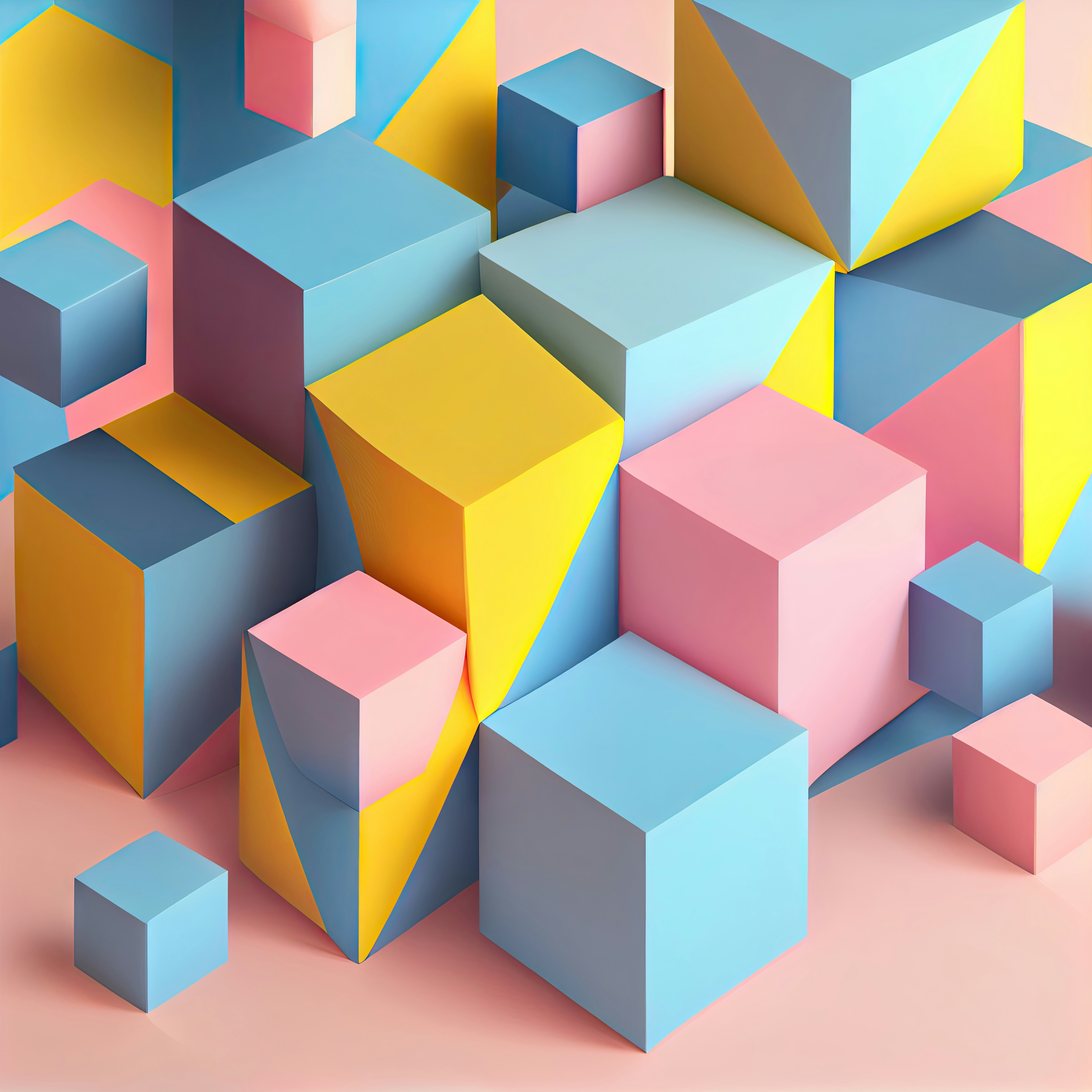





















.jpg)